
Es ist ein Sommertag im August 1973. Während die offizielle Jugend der DDR bei den X. Weltfestspielen in Berlin ein staatlich kontrolliertes „Woodstock des Ostens“ feiert, zelebriert ein 14-jähriger Autodidakt auf einem Hof in Seebenisch sein eigenes Festival. Mit sechs Zuhörern, von denen wenigstens drei keine Ahnung haben, was der Junge da spielt. Sie wollen eigentlich nur mal seine Gitarre anfassen. Die ist nun, 44 Jahre später, verstummt. Zusammen mit einer markanten Stimme und einem begnadeten Vollblut-Musiker.
Normalerweise gab es zu jener Zeit in den Abendstunden ganz andere Klänge auf dem Dorfe. Das Muhen von Kühen beispielsweise, das Zirpen von Grillen, gackernde Hühner und manchmal gab es auch ein lautes Knarzen, wenn irgendwo ein Scheunentor geschlossen wurde. In der Ferne fraß sich vielleicht noch ein Mähdrescher durchs Getreide, aber das wars dann schon mit der ländlichen Geräuschkulisse.
Da spitzt man automatisch die Ohren, wenn plötzlich ganz andere Harmonien durch die Luft schwirren und noch dazu jemand singt. Der da auf dem Hofe seines Kumpels die Gitarre ausgepackt hatte, hieß mit bürgerlichem Namen Kautzleben.
Der große und der kleine Kautzer
Die meisten seiner Freunde und auch die anderen Altersgenossen in der Schule wussten mitunter jedoch noch nicht einmal, dass er mit Vornamen Peter hieß. Er war einfach nur der Kautzer.
Dass auch sein jüngerer Bruder von seinen Schulfreunden auf den gleichen Namen getauft wurde, barg kein Konfliktpotenzial. Ralf spielte Fußball und Peter Gitarre, da kommt man sich auch als Kautzer nicht in die Quere. Notfalls sprach man eben vom großen oder dem kleinen Kautzer.
Geheimnisvolles Vorbild
Der „große Kautzer“ passte irgendwie nicht so recht in ein beschauliches Dörfchen wie Seebenisch. Schon als Jugendlichen zog es ihn dahin, wo die Musik spielte. Und weil von seinen Fußball spielenden Kumpels kaum einer wusste, wo das war, umgab den Kautzer schon als Teenager eine geheimnisvolle Aura.
Manche Eltern sahen das mit gewisser Sorge und warnten ihre Kinder, dass der Kautzer kein Vorbild sei, wenn „später mal was aus dir werden soll“. Je lauter diese Warnungen wurden, desto neidischer blickte die Dorfjugend auf den jungen Mann, dem diese Spießereien galten und der sich darum nicht scherte.
Ein Musikant, oweh!
Bald schon wurde die Kautzer’sche Philosophie sogar kulturell legitimiert. In „Cäsars Blues“ besang Renft ausgerechnet jenes Phänomen, in dem Eltern ihre Tochter vor einer Liaison mit einem Musiker warnen. „Ein Musikant, oweh, hat doch nichts im Portemonnaie“, hieß es da und „Nie wird ein Musikant zum Gärtner, da wo man das Glück aufspießt und sich gegen Geld nur grüßt“.
Wenn der Kautzer dann doch mal irgendwo im Dorfe auftauchte, hatten die Durchschnittsjungs mit einem Schlage sämtliche Chancen bei den anwesenden Mädchen verloren.
Staunende Statisten
Gegen Freiheit und Abenteuer verheißende lange Haare und den Hut ließ sich mit Seitenscheitel und Schlaghosen allein schon nicht ankommen, und wenn er dann noch zur Gitarre griff, wurden die umher stehenden Jungs unversehens zu staunenden Statisten einer Szene aus Ehrfurcht und Sehnsucht.
Der Kautzer ging immer schon seinen eigenen Weg. Ihn kümmerte der Mainstream wenig.
Während andere Altersgenossen mit ihren ersten Kassettenrecordern den Schmalz des „Sugar Baby Love“ der Rubettes aus den Lautsprechern tropfen ließen, war der Kautzer längst beim Blues angekommen.
Nicht nur angekommen – er lebte den Blues. Als Autodidakt ohne Musikschul-Abschluss hatte er jedoch keine Chance, an die „Pappe“ zu kommen. Der Ausweis als Berufsmusiker war eine der wichtigsten Grundlagen, um in der DDR als Künstler wirtschaftlich überleben zu können.
Nur wer die „Pappe“ hatte, durfte auf die Vermittlung von Auftritten durch die Konzert- und Gastspieldirektion (KGD) hoffen. Dass der Kautzer schon als 18-jähriger besser war als viele seiner studierten und erfahrenen Berufskollegen, spielte da keine Rolle.
So blieben ihm zunächst nur die Muggen (Mugge = Musikalisches Gelegenheitsgeschäft) mit Gagen, die bei Gruppen wie Karussell, Karat oder den Puhdys nicht mal für die backstage servierten Drinks gereicht hätten.

Der Kautzer beim Seebenischer OpenAir 1999. Auch in diesem Jahr sollte er hier wieder auf der Bühne stehen… Fotos (2): Andreas Müller
Der Kautzer war wohl das, was man landläufig unter einem Lebenskünstler versteht. Er spielte in kleinen Dorfsälen und Kneipen, denen er damit zum Prädikat „Geheimtipp“ verhalf. Es war die Zeit Ende der 70-er Jahre, als die Blueshöhlen entstanden. Sozusagen der alternative Gegenentwurf zur bürgerlich geprägten Pop-Musik und ihren Glitzerbühnen.
Die „Blueser“, die sich selbst „Kunden“ nannten und deren Freundinnen einheitlich „Käthe“ hießen, trugen Tramper-Schuhe, abgewetzte Jeans und grüne Parka. Und selbstverständlich zierten deren Häupter lange Haare, die als „Matte“ in den Sprachgebrauch eingingen. So zogen sie ihren Idolen Stefan Diestelmann, Hansi Biebl, Jürgen Kerth oder eben auch dem Kautzer quer durch die Republik hinterher.
Mitte der 80-er Jahre war der Kautzer von offizieller Seite zwar noch immer nicht als Berufsmusiker anerkannt, doch unter seinen Profi-Kollegen genoss er längst den Respekt als einer der Ihren.
Mal allein, mal mit seiner Band Lilienthal (mit der er auch in Kulkwitz beim Groitzscher legendäre Sessions feierte) und später dann mit mit Peter’s Deal, wurde ab 1984 aus dem einstigen Geheimtipp eine feste Größe in der ostdeutschen Blueser-Szene. Der Kautzer hatte inzwischen seinen eigenen, individuellen Stil gefunden, fernab vom klischeehaften Covern internationaler Stars.
Nach der Wiedervereinigung folgte dann erst einmal der für ostdeutsche Biografien übliche Knick. Über Nacht hatten sich die Bedürfnisse den neuen Angeboten angepasst und das Publikum lechzte nach Bananen statt Blues.
Dem Kautzer war der Umgang mit der Situation eines Nischen-Daseins aber nicht neu und so platzte 1992 mitten in den Konsum-Rausch hinein die erste CD. Geradezu sinnstiftend ihr Titel: „Too Much“. Auch das zweite Album, das 1999 erschien, trägt einen vielsagenden Namen. „Friends“ heißt die Scheibe. Und tatsächlich wurden die Titel daraus dann auch ausgerechnet vor langjährigen Freunden live zelebriert. Peter’s Deal spielte in jenem Jahr zum 3. OpenAir in Seebenisch auf.
OpenAir-Legende
Auch beim 4. OpenAir im Juni 2000 und bei der 13. Auflage anno 2009 kehrte der Kautzer zurück zu den Seebenischer Wurzeln.
In wenigen Tagen, am 19. August, sollte Peter’s Deal zum 20. OpenAir-Jubiläum erneut auf der Bühne an der Alten Gärtnerei stehen. Aber daraus wird nichts. Der Mann, der von der Suche nach den wesentlichen Dingen des Lebens und der Sehnsucht nach Freiheit sang, hat sich am 9. Juli selbst auf den Weg gemacht. Den Weg, den vor ihm bereits seine Vorbilder B. B. King. J. J. Cale oder Johnny Guitar Watson gegangen sind. Peter Kautzleben starb im Alter von nur 58 Jahren.
Er wird trotzdem irgendwie dabei sein, wenn sich das Licht der Scheinwerfer am 19. August in Seebenisch auf die beiden Festivalbühnen richtet. Und mit Sicherheit wird es im Publikum auch mehr als den einen Augenblick offiziellen Gedenkens geben, in dem der Kautzer noch einmal für einen kurzen Moment auf die Bühne kommt.
Spätestens wenn der Mann mit dem langen Haar unter dem Hut auf der Leinwand erscheint und seine Hymne „I’m on my way“ noch einmal erklingt, werden ihm wohl auch unsere Eltern verziehen haben, dass wir auf den Schwarz-Weiß-Fotos von damals so schrecklich aussehen mit unseren Matten und den verlotterten Studentenkutten. Aus uns ist nicht trotzdem, sondern gerade deshalb was geworden.
Rest in peace, Kautzer.








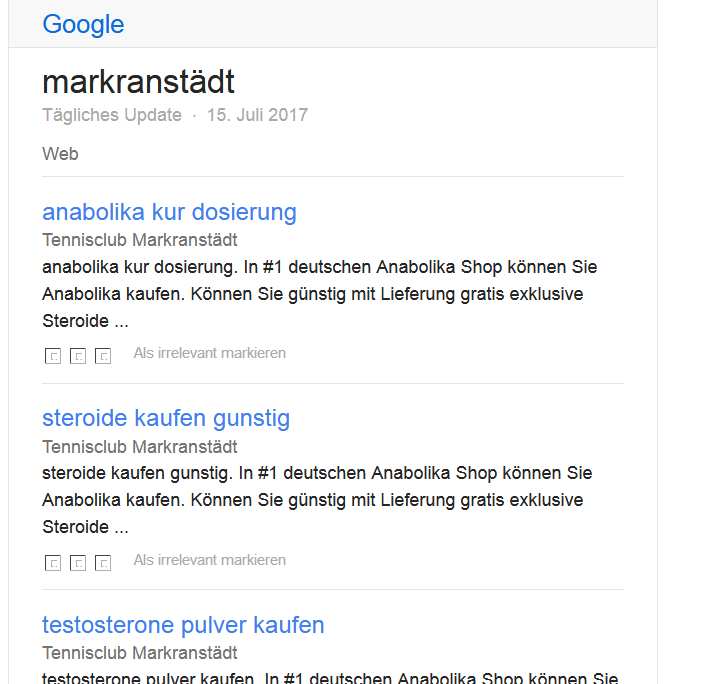
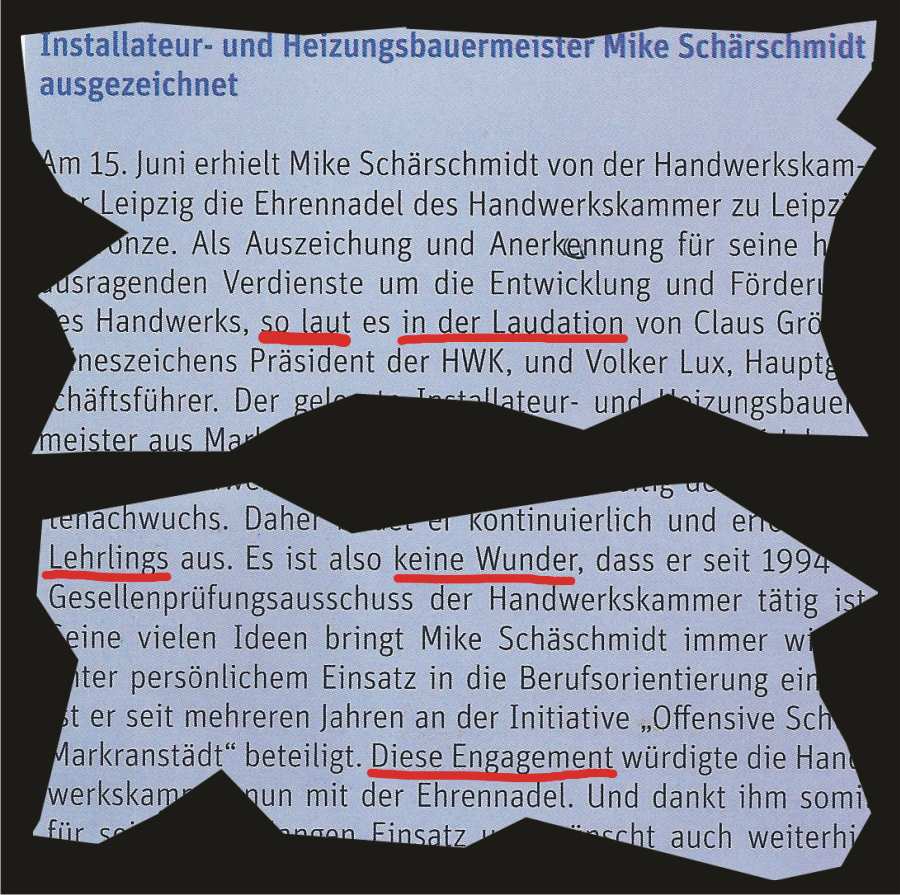







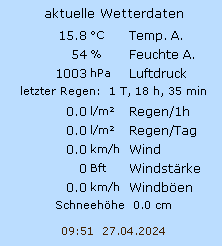















Letzte Kommentare